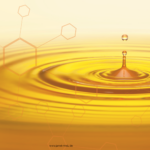
Kolloide Nährstoffe
24.06.2024Was steckt hinter MIM?
In meinen Beratungen begegnet mir das Thema MIM (Muscle Integrity Myopathy) immer häufiger. Pferdehalter erzählen mir, dass ihr Pferd darauf getestet wurde – oder dass der Verdacht im Raum steht, weil sich bestimmte Symptome zeigen: Muskelverspannungen, Leistungsabfall, Steifheit oder einfach das Gefühl, „irgendetwas stimmt nicht“.
Auch ich nehme diese Beobachtungen ernst. Denn natürlich möchte jeder Pferdebesitzer verstehen, was hinter solchen Beschwerden steckt – und das Beste für sein Pferd tun. Gleichzeitig stelle ich fest, dass rund um den Begriff MIM viel Verunsicherung herrscht.
Was bedeutet ein positives Testergebnis?
Ist das eine Diagnose?
Und was hat es mit der „besonderen MIM- Fütterung“ auf sich?
In diesem Beitrag möchte ich dir eine fundierte, sachliche Einordnung geben – basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, meinen Erfahrungen als Fütterungs- und Gesundheitsberaterin und der Beobachtung vieler Pferde in der Praxis.
MIM – Test
Du hast bestimmt auch schon vom sogenannten „MIM-Test“ gehört – einem Gentest, der auf eine mögliche Muskelstörung beim Pferd hinweisen soll.
Viele Pferdebesitzer sind verunsichert, weil sie auf der Suche nach Antworten für die Symptome ihres Pferdes auf diesen Begriff stoßen.
Vielleicht wurde dein Pferd bereits getestet – mit einem positiven oder auch negativen Ergebnis – und du fragst dich jetzt: Was bedeutet das eigentlich?
Gefühlt ist MIM derzeit überall. Aus meiner Sicht ist dabei wichtig zu verstehen, wie dieser Test entstanden ist und wie er momentan wissenschaftlich einzuordnen ist.
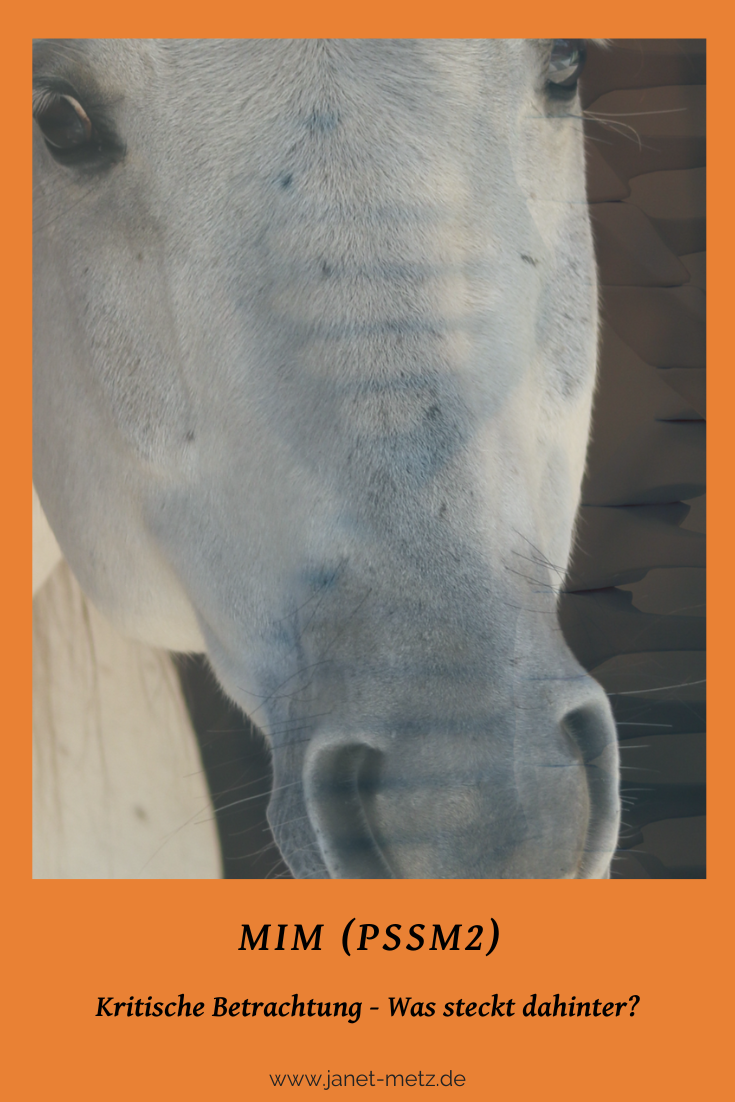
Was genau ist eigentlich PSSM2 – und wieso nennt man es jetzt MIM?
Der Begriff PSSM2 entstand ursprünglich in Anlehnung an PSSM1 (Polysaccharid-Speicher-Myopathie Typ 1), eine gut erforschte, genetisch klar definierte Muskelerkrankung, bei der eine Mutation im GYS1-Gen nachgewiesen wurde. Diese führt zu einer fehlerhaften Speicherung von Glykogen in der Muskulatur und ist eindeutig genetisch testbar und klinisch relevant.
Als man bei manchen Pferden ähnliche Symptome wie bei PSSM1 beobachtete – aber keine GYS1-Mutation finden konnte – wurde ein neuer Begriff eingeführt: PSSM2.
Die Hoffnung war, andere Genveränderungen zu finden, die diese Symptome erklären.
Kommerzielle Labore begannen daraufhin, verschiedene weitere Gene zu untersuchen – etwa MYOT, FLNC, MYOZ3, P2, P3, P4, P8, Px, K1 – und bezeichneten positive Testergebnisse als „PSSM2“. Doch die wissenschaftliche Validierung dieser Tests fehlt bis heute. Studien zeigten, dass diese Genvarianten auch bei gesunden Pferden vorkommen und nicht zuverlässig mit Symptomen zusammen hängen.
Die Gene MYOT, FLNC, MYOZ3 sind aus der Humanmedizin bekannt, wo sie mit bestimmten erblichen Muskelkrankheiten in Verbindung gebracht werden – insbesondere mit Myofibrillären Myopathien (MFM). Beim Pferd ist bisher nicht belegt, dass Varianten in diesen Genen dort eine vergleichbare Erkrankung verursachen.
Die Bezeichnungen P2, P3, P4, P8, Px, K1 stammen aus den kommerziellen Gentest-Panels von Laboren. Sie dienen als interne Bezeichnungen für bestimmte Genabschnitte oder Varianten – wobei z. B.: P2 für eine Variante im MYOT-Gen steht, P3 für eine im FLNC-Gen, P4 für eine im MYOZ3-Gen, P8 für PYROXD1, K1 für COL6A3. PX ist ein weiterer laborspezifischer Marker, über dessen genaue genetische Zuordnung bisher keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen. In Laborangaben wird vermutet, dass PX mit der Calciumverwertung in Zusammenhang stehen könnte, doch dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich nicht belegt und die genetische Grundlage von PX nicht veröffentlicht.
Diese Zuordnungen wurden also nicht durch unabhängige wissenschaftliche Studien bestätigt und sind nicht Teil eines anerkannten veterinärmedizinischen Klassifikationssystems.
Die getesteten Varianten sind nicht validiert, ihre Bedeutung für die Pferdegesundheit ist unbekannt, und sie sind derzeit nicht als krankheitsauslösend anerkannt.
PSSM2 hat nichts mit PSSM1 zu tun
Daraus resultierte massive Kritik aus der Fachwelt. Um sich von der problematischen Gleichsetzung mit PSSM1 abzugrenzen, wurde der Begriff MIM (Muscle Integrity Myopathy) eingeführt – allerdings ohne wissenschaftlich neue Grundlage.
Zusammengefasst:
- PSSM1 = eine klar definierte Krankheit mit bekannter Mutation → GYS1-Test ist validiert
- PSSM2 = Sammelbegriff für Pferde mit ähnlichen Symptomen, aber ohne GYS1-Mutation → keine validierten Gene, unklare Aussagekraft
Umbenennung in MIM, nachdem sich herausstellte, dass die getesteten Gene nicht mit PSSM zu tun haben.
Ursprünglich wurden Pferde mit muskulären Symptomen, aber ohne GYS1-Mutation, also unter dem Begriff PSSM2 zusammengefasst – in Anlehnung an die gut erforschte PSSM1.
Die Hoffnung war, andere genetische Ursachen für ähnliche Symptome zu finden.
Später zeigte sich jedoch in unabhängigen Studien, dass die dafür getesteten Genvarianten nicht zuverlässig mit klinisch relevanten Muskelerkrankungen zusammenhängen.
Um sich von der problematischen Gleichsetzung mit PSSM1 abzugrenzen, wurde daraufhin der Begriff MIM (Muscle Integrity Myopathy) eingeführt – allerdings bislang ohne neue wissenschaftliche Grundlage oder validierte Definition.
MIM, Validierung und der Vergleich zu PSSM1 – warum das nicht dasselbe ist
In Diskussionen rund um den MIM-Test höre ich häufig das Argument:
„Man arbeitet ja bereits an der Validierung – bei PSSM1 war das doch am Anfang auch so und man hat es geleugnet.“
Das klingt verständlich – doch bei genauerer Betrachtung sind die beiden Fälle nicht vergleichbar. Im Gegenteil: Der Weg zur Erkenntnis war bei PSSM1 und MIM/PSSM2 genau entgegengesetzt.
PSSM1 – erst existierte das Krankheitsbild, dann der Test
Bei PSSM1 stand zuerst die klinisch klar beschriebene Krankheit im Vordergrund. Man wusste:
- Welche Symptome auftreten,
- wie die Muskelbiopsien aussehen,
- und wie sich die Erkrankung im Stoffwechsel äußert.
Erst auf Basis dieser klaren Symptome wurde gezielt nach einer genetischen Ursache gesucht – und man fand eine klare Mutation im GYS1-Gen, die in nahezu allen betroffenen Pferden vorkam, aber bei gesunden Pferden eben nicht.
Die Erkenntnisse wurden mehrfach unabhängig überprüft und publiziert – erst dann wurde ein Gentest entwickelt. Das ist Wissenschaft.
MIM/PSSM2 – erst existiert ein Test, dann wird nach einer Bedeutung gesucht
Beim sogenannten PSSM2- oder MIM-Test war es umgekehrt:
- Es wurden Genvarianten gefunden, deren Bedeutung für die Muskulatur unklar war.
- Der Test wurde auf den Markt gebracht, bevor klar war, ob die Varianten überhaupt eine Krankheit auslösen.
- Erst danach begannen Studien – bisher ohne belastbaren Zusammenhang zwischen den Genvarianten und klinischen Symptomen.
- Viele gesunde Pferde sind positiv getestet, viele symptomatische Pferde sind negativ.
Der Test kam also vor der wissenschaftlichen Erkenntnis – und genau das ist problematisch.
Was sagt das Labor selbst?
Das Labor, dass den MIM-Test vertreibt, räumt auf seiner Webseite ein, dass es keine offizielle Verpflichtung zur Validierung solcher Tests gibt und dass die Aussagekraft derzeit nicht wissenschaftlich abgesichert ist.[1]
Die getesteten Gene könnten Muskelveränderungen mit beeinflussen – ob sie krank machen, ist derzeit unklar.
Was sagen unabhängige Experten?
Die British Equine Veterinary Association (BEVA) sowie die Universität Utrecht warnen ausdrücklich vor der Nutzung nicht validierter Gentests für PSSM2, MFM oder MIM.[2]
Auch erfahrene Tierärztinnen wie Dr. Eleanor Kellon kritisieren öffentlich, dass der MIM-Test bislang keine wissenschaftlich fundierte Diagnose liefert, sondern auf einem kommerziellen Screening basiert, das nie validiert wurde.[3] Und auch an anderen unabhängigen Stellen findet man Kritik [4] [5] [6].

Was misst der MIM-Test – und was sagt er letztlich über den Gesundheitszustand eines Pferdes aus?
Technisch gesehen kann der Test bestimmte Genvarianten korrekt nachweisen. Es handelt sich also um einen funktionierenden genetischen Nachweis –ABER:
Was diese Genvarianten bedeuten, ist wissenschaftlich bislang nicht geklärt.
- Es gibt gesunde Pferde mit positivem Testergebnis, die keinerlei Symptome zeigen.
- Und es gibt Pferde mit deutlichen Symptomen, deren Test negativ ausfällt.
Genau das ist das Kernproblem: Die wissenschaftliche Validierung fehlt.
Es ist bisher nicht belegt, dass die getesteten Varianten tatsächlich eine Muskelerkrankung auslösen bzw. die Symptome macht, wenn welche vorhanden sind und somit überhaupt krankheitsrelevant sind. Aus dem Humanbereich ist nicht nur bekannt, dass gewisse Varianten Probleme machen können, sondern auch, dass gewisse Mutationen unproblematisch sind. Ohne validierte Studien am Pferd lässt sich daher nicht beurteilen, ob die getesteten Varianten überhaupt krankheitsrelevant sind.
Was wäre für eine Validierung notwendig?
Damit ein Gentest medizinisch wirklich aussagekräftig ist, müsste er mehrere Kriterien erfüllen:
- Erkrankte Pferde müssten die Genvariante signifikant häufiger tragen als gesunde.
- Gesunde Kontrollpferde dürften die Variante nur selten oder gar nicht aufweisen.
- Es müsste klar sein, wie die Genvariante vererbt wird – und welche Träger (einfach, doppelt) wirklich ein Risiko für eine Erkrankung haben.
- Die Aussagekraft müsste durch unabhängige Studien in Fachzeitschriften bestätigt sein.
All das liegt im Fall von MIM bislang nicht vor.
Es wird immer wieder behauptet es gäbe doch bereits schon viele Studien. Die Forschung, die die behaupteten Zusammenhänge belegen soll, wurde bislang nicht veröffentlicht oder ist ergebnislos.
Die wenigen unabhängigen Studien, die bereits veröffentlicht wurden, konnten die behaupteten Zusammenhänge bisher nicht bestätigen – im Gegenteil: Sie sprechen eher dagegen.
Deshalb wird der Test von vielen Fachleuten und Organisationen kritisch gesehen – und derzeit nicht als diagnostisches Mittel empfohlen. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Und was ist mit der „MIM-Fütterung“, die ja sogar beim Pferd sichtbar angeschlagen hat?
Vielleicht hast du dein Pferd „wie ein MIM Pferd“ gefüttert – und es geht ihm nun deutlich besser. Das freut mich sehr. Aber: Auch das ist kein Beweis für die Richtigkeit der „MIM-Diagnose“.
Denn diese „MIM-Fütterung“ basiert letztlich häufig auf einer sehr durchdachten, orthomolekularen Versorgung, die viele Pferde heutzutage eben brauchen – ganz unabhängig vom Gentest! Es bedeutet bedarfsgerechte Pferdefütterung.
- Hochwertige Proteine und essentielle Aminosäuren (z. B. Lysin, Methionin, Threonin),
- ein ausgewogenes Verhältnis an Mineralstoffen, insbesondere Magnesium,
- eine gezielte Versorgung mit Vitamin E, Selen, B-Vitaminen,
- und eine angepasste Energieversorgung – meist strukturreich, magenfreundlich und ohne unnötige Stärke.
Diese Form der Fütterung ist für ALLE Pferde sinnvoll – nicht nur für MIM-Positive.
In vielen Fällen zeigt sich bei näherer Betrachtung: Das Pferd war vorher schlicht unterversorgt oder nicht bedarfsgerecht gefüttert.
Und nach der Futterumstellung ist es das halt und es tut dem Pferd gut. Deshalb sollten wir auch ein MIM positives Pferd nicht automatisch als „krank“ ansehen.
Letztlich muss jedes Pferd nach seinen individuellen Bedürfnissen gut gemanagt werden. In allen Bereichen. Gute Pferdehaltung halt.
Achte auf die Ursachen, nicht auf das Etikett
Die Symptome, wegen denen ein Pferd überhaupt getestet wird – wie Muskelverspannungen, Steifheit, Leistungsabfall oder Bewegungsunlust – sind unspezifisch.
Sie treten auch bei zahlreichen anderen Problemen auf, zum Beispiel bei:
- Protein- oder Aminosäurenmangel,
- Elektrolyt- oder Magnesiumdefiziten,
- Mangel an B-Vitaminen oder Vitamin E,
- orthopädischen Problemen,
- Magen-Darmproblemen
- Übergewicht
- chronischem Stress durch Krankheit oder unpassender Haltung oder Überforderung jeglicher Art.
Der MIM-Test ersetzt keine weitere Ursachenforschung!
Im Gegenteil: Ein vorschnelles Vertrauen in das Testergebnis kann dazu führen, dass andere, wirklich relevante Ursachen übersehen werden.
Meine zusammengefasste Einschätzung für dich:
- Der MIM-Test kann bestimmte Gene nachweisen – aber ob diese krank machen und mit Symptomen in Zusammenhang stehen, ist nicht belegt.
- Viele Pferde profitieren von der sogenannten „MIM- Fütterung“, weil sie endlich bedarfsgerechter versorgt werden – nicht, weil sie MIM haben. Aber man kann es am Ende nennen, wie man will. Wenn es dabei hilft, dass ein Pferd bedarfsgerechter ernährt wird, ist ihm geholfen.
- Viele Symptome entstehen nicht durch eine einzige Ursache, sondern sind multifaktoriell bedingt. Genetik kann dabei eine Rolle spielen – ist aber nur ein Baustein in einem komplexen Zusammenspiel aus Haltung, Fütterung, Umweltfaktoren und individueller Konstitution. Eine fundierte Fütterung, ganzheitlich durchdacht und auf dein Pferd abgestimmt, ist immer der richtige Weg – unabhängig von einem Testergebnis.
Eine fundierte Fütterung, ganzheitlich durchdacht und individuell auf dein Pferd abgestimmt, ist immer der richtige Weg – ganz unabhängig vom Testergebnis
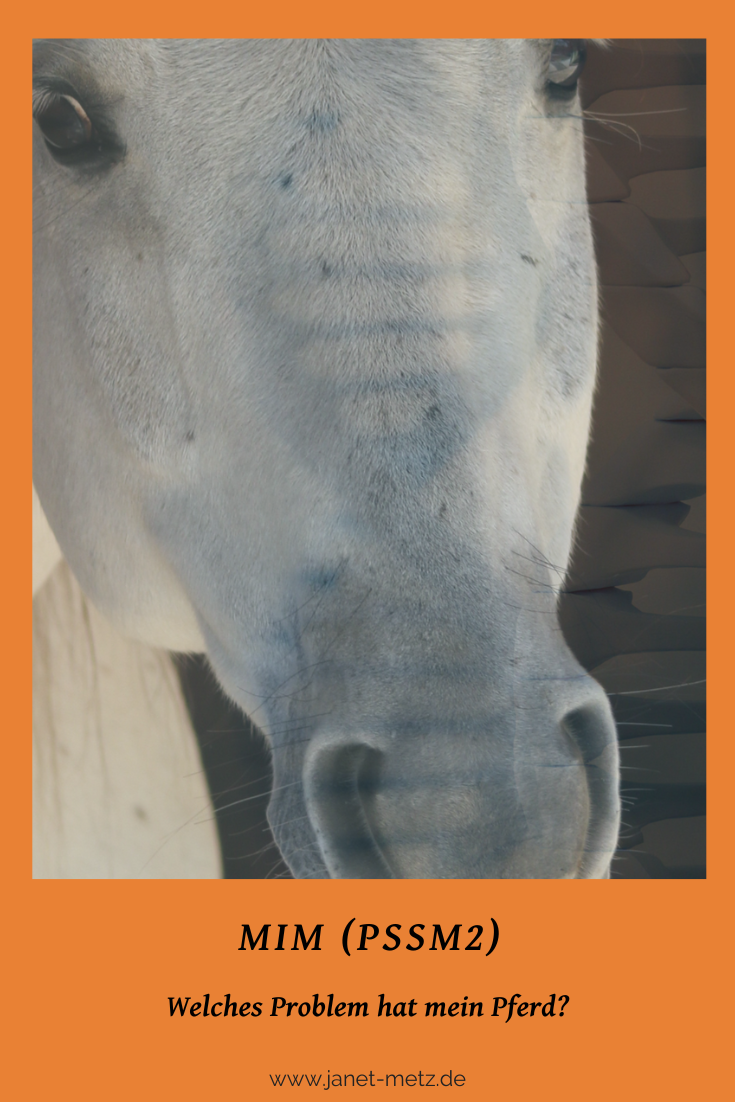
Wenn es vielleicht gar nicht MIM ist – was steckt dann wirklich hinter den Symptomen deines Pferdes?
Pferdebesitzer mit einem Pferd mit MIM-Verdacht berichten häufig von dramatischen Verhaltensveränderungen bei ihren Pferden.
Plötzliche Schreckhaftigkeit, panikartige Reaktionen beim Reiten, unkontrollierbares Hochspringen, Muskelverspannungen oder Bewegungsprobleme, die scheinbar aus dem Nichts auftreten.
Viele fühlen sich hilflos – und suchen nach einer greifbaren Erklärung.
Ein naheliegender Verdacht fällt dann oft auf MIM, also eine genetische Form der Muskelerkrankung. Die Symptome scheinen zu passen – und die Unsicherheit ist groß.
Doch in der Praxis zeigt sich immer wieder:
Nicht jedes Pferd mit solchen Symptomen hat MIM – sehr häufig lassen sich durchaus andere Ursachen finden.
1. Nährstoffmängel als unterschätzte Ursache
Viele Symptome, die wir bei Pferden heute beobachten – ob Muskelverspannungen, Schreckhaftigkeit, Leistungsabfall oder Verhaltensauffälligkeiten – haben ihre Ursache nicht im Charakter, sondern in einem ungleichgewichtigen Nährstoffhaushalt.
Besonders betroffen sind Pferde, die:
- sensibel und leistungsbereit sind
- mit energiereichem, aber nährstoffarmem Futter versorgt werden
- in einem Umfeld leben, das viel Stress und wenig Regeneration erlaubt
Mängel an Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren oder Vitaminen entstehen häufig durch:
- nährstoffarmes Heu
- unzureichende oder unausgewogene Mineralfutter
- hoher Verbrauch bei Stress, Wachstum, Training oder Krankheit
- schlechte Aufnahmefähigkeit durch Magenprobleme oder Darmflora-Störungen
Die Folgen sind vielfältig – von Muskelverspannungen über Koordinationsprobleme bis hin zu explosivem Verhalten oder chronischer Erschöpfung. Viele dieser Symptome werden fälschlicherweise als „Ungehorsam“ oder „psychisches Problem“ interpretiert.
Doch solche Auffälligkeiten sind kein Zeichen von Bösartigkeit, sondern oft ein Hilferuf des Körpers.
Nährstoffmängel sind kein Endpunkt – sondern ein Hinweis darauf, dass im Gesamtsystem etwas nicht stimmt. Sie sollten immer Anlass sein, genauer hinzusehen und Fütterung, Haltung und Gesundheit ganzheitlich zu hinterfragen.
2. Auch Überversorgungen können derartige Symptome machen!
Ein Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Möglichkeit von Überversorgungen, die ähnlich belastende Symptome hervorrufen können wie Mangelzustände. Gerade im Zusammenhang mit Muskelproblemen lohnt sich z.B. auch ein kritischer Blick auf den Selengehalt im Futter zu werfen.
Denn:
- Eine chronisch zu hohe Selenzufuhr z.B. kann muskuläre Symptome wie Steifigkeit, Schmerzen oder Leistungsabfall auslösen. Und Selenüberversorgungen kommen mit unserem Futtermittelmarkt leider gar nicht so selten vor.
- Auch andere Nährstoffe wie Vitamin D oder Eisen können bei Überdosierung den Stoffwechsel empfindlich stören.
- In meiner Praxis sehe ich vor allem bei den sogenannten MIM-Pferden regelmäßig sehr überdosierte Rationen – insbesondere durch die Kombination mehrerer stark angereicherter Futterergänzer aus dem MIM-Bereich in Kombination mit Mono Ergänzern.
Nicht jede muskuläre Problematik ist auf einen Mangel zurückzuführen. Manchmal liegt das Problem auch im Zuviel. Eine fundierte Rationsüberprüfung sollte daher nicht nur auf Mängel achten, sondern auch auf kritische Überschüsse – gerade bei empfindlichen Pferden!
3. Stress durch Überreizung, Fehlhaltung und Überforderung
Gerade bei hochsensiblen Pferden kann ständiger Stress zu massiven Regulationsproblemen führen. Viele dieser Pferde:
- leben in nicht passenden Gruppenhaltungen und auch oft mit zu wenig Platz.
- sind durch Training, Reizüberflutung oder zu hohen Leistungsdruck dauerüberfordert.
- werden von Reitern geführt, die (verständlicherweise) überfordert sind mit der Komplexität der Problematik.
Das Ergebnis: Ein Pferd, das innerlich unter Spannung steht – und irgendwann eskaliert.
4. Unentdeckte Schmerzen – Magen, Bewegungsapparat, Übergewicht, Faszien
Ein Pferd, das sich plötzlich verweigert oder extrem reagiert, hat nicht selten Schmerzen, die nicht erkannt wurden. Häufige Ursachen sind:
- Magengeschwüre oder Magenreizungen (auch ohne typische Symptome)
- Blockaden, Faszienprobleme, unentdeckte Verletzungen
- Entzündliche Prozesse im Bewegungsapparat oder durch Übergewicht.
- Falsch angepasste Ausrüstung (Sattel, Gebiss, etc.); nicht förderliches und passendes Training.
Schmerz wird oft als „Ungehorsam“ missverstanden – dabei ist es ein Hilferuf. Das Fluchttier Pferd versucht im Zweifel eben durch Flucht aus einer ungünstigen Situation zu entkommen.
5. Entzündung durch Übergewicht und Stoffwechselprobleme
Viele Pferde leiden heute an latenten Entzündungsprozessen, die durch Übergewicht und EMS entstehen. Fettgewebe ist hormonell aktiv und produziert entzündungsfördernde Stoffe, die den gesamten Organismus belasten können.
Die Folge:
- das Pferd fühlt sich buchstäblich nicht mehr wohl in seiner Haut
- Muskeln verspannen
- die Leistungsbereitschaft sinkt
- jede Bewegung wird zur Qual – vor allem unter dem Reiter
Wird dann „mehr Training“ angesetzt, verschärft das Problem die Situation häufig noch.
Fazit für dich als Pferdebesitzer:
Wenn dein Pferd plötzlich unerklärliche Symptome zeigt – Schreckhaftigkeit, Verweigerung, Verspannung, Panik – dann lohnt es sich, nicht vorschnell auf eine genetische Muskelerkrankung zu schließen.
Stattdessen braucht es:
- eine genaue Analyse der Haltung, Fütterung und Stressfaktoren
- eine umfassende Schmerz- und Stoffwechseldiagnostik (ohne NährSTOFF kein STOFFWECHSEL)
- ein ganzheitliches Verständnis für das Zusammenspiel von Körper und Verhalten.
Pferde zeigen Symptome nie ohne Grund!
Sie sprechen durch ihr Verhalten – und es liegt an uns, richtig hinzuhören und sie zu verstehen.
Quellen:
[1] https://generatio.de/en/expertise/mim-pssm2-horse/our-dna-test/faq?utm_source=chatgpt.com
https://generatio.de/en/expertise/mim-pssm2-horse/our-dna-test/faq?utm_source=chatgpt.com





2 Comments
Excellent article! Thank you for telling the truth. I just want to point out there are some other genetic diseases that have been properly scientifically proven – Hyperkalemic Periodic Paralysis (HPP), Malignant Hyperthermia (MH), and Myosin Heavy Chain Myopathy (MYHM) which has two different presentations – Immune Mediated Myopathy (IMM) and nonexertional rhabdomyolysis, In addition, there is muscle loss with equine motor neuron disease which is usually associated with vitamin E deficiency and Equine Protozoal Myeloencephalopathy (EPM). There are undoubtedly more to be discovered but MIM has no basis in fact. PSSM2 received it’s name because of similarities to PSSM1 on biopsy.
Dear Dr. Kellon,
thank you so much for your kind and appreciative comment. I feel truly honored that you took the time to read my article and to share your professional insights. Your additions regarding the scientifically proven muscle diseases are extremely valuable and complement the topic in a very meaningful way. I fully agree with you: Distinguishing between evidence-based diagnoses and unvalidated terms like MIM is essential – both for veterinarians and horse owners. Thank you for your tireless work and your dedication to educating the equine community about metabolic and muscular disorders.
Warm regards from Germany,
Janet Metz